04.02.2026

Armutsgefährdung
In der Süddeutschenzeitung ist zu lesen: "Etwa 13,3 Millionen Menschen gelten inzwischen als armutsgefährdet, fast jeder sechste. Die SPD warnt vor Kürzungen bei der sozialen Sicherung. Die Union setzt darauf, die Menschen mit strengeren Regeln und Anreizen in Arbeit zu bringen."
Die Zahl ist ein Alarmsignal: Wenn fast jeder sechste Mensch als armutsgefährdet gilt, dann ist Armut kein Randphänomen mehr, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. In dieser Lage wirkt der politische Reflex, den Schwerpunkt vor allem auf „strengere Regeln“ zu legen, mindestens verkürzt. Arbeit ist wichtig, keine Frage – aber sie ist längst keine Garantie mehr gegen Armut. Wer Vollzeit arbeitet und dennoch kaum über die Runden kommt, braucht keine zusätzlichen Sanktionen, sondern bessere Löhne, verlässliche Arbeitszeiten und bezahlbaren Wohnraum.
Die SPD hat recht, wenn sie vor Kürzungen bei der sozialen Sicherung warnt. Ein Sozialstaat ist kein Luxus für gute Zeiten, sondern ein Sicherheitsnetz für Krisen – und wir leben offenkundig in solchen. Wer hier spart, riskiert nicht nur individuelle Abstiege, sondern auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Armut vererbt sich, sie schränkt Bildungschancen ein und erzeugt Frust, der politisch explosiv werden kann.
Die Union wiederum setzt auf Anreize und Pflichten, um Menschen in Arbeit zu bringen. Das kann sinnvoll sein – aber nur dort, wo passende, existenzsichernde Arbeit auch tatsächlich vorhanden ist. Anreize ohne Perspektiven laufen ins Leere, Härte ohne soziale Absicherung wird schnell zur Bestrafung der Falschen. Die eigentliche Aufgabe wäre, beide Ansätze zusammenzudenken: einen starken Sozialstaat, der absichert, und eine Arbeitsmarktpolitik, die gute Arbeit schafft. Alles andere ist Symbolpolitik auf dem Rücken von Millionen.
 Keine Kommentare
Keine Kommentare29.01.2026

Wenn ein Kardinal nicht mehr zuhört
Kardinal Woelki erklärt den synodalen Weg für beendet. Nicht, weil die Krise der Kirche überwunden wäre. Nicht, weil Vertrauen zurückgewonnen wurde. Sondern weil ihm der Dialog offenbar zu unbequem geworden ist. Diese Entscheidung ist kein Akt der Klarheit – sie ist ein Akt der Verweigerung.
Wer heute den synodalen Weg verlässt, verlässt Menschen. Er verlässt jene, die verletzt wurden und trotzdem geblieben sind. Er verlässt jene, die auf Aufarbeitung, auf Veränderung, auf eine Kirche hoffen, die endlich zuhört, statt sich hinter Mauern aus Macht und Dogma zu verschanzen. Gerade nach dem Missbrauchsskandal ist Schweigen, Abwenden und Abgrenzen keine Option mehr. Und doch genau das geschieht.
Woelki sendet damit eine erschütternde Botschaft: Eure Stimmen sind verzichtbar. Eure Fragen sind lästig. Eure Hoffnungen stehen unter Vorbehalt römischer Genehmigung. Das ist keine geistliche Führung, das ist kalte Verwaltung von Autorität. Wer so handelt, hat die Wucht der Vertrauenskrise entweder nicht verstanden – oder er nimmt sie bewusst in Kauf.
Es schmerzt zu sehen, wie ein Kardinal, der selbst im Zentrum massiver Kritik stand, den einen Prozess verlässt, der überhaupt noch die Chance bot, verlorene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Demut würde bedeuten zu bleiben. Sich auszuhalten. Widerspruch zu ertragen. Verantwortung zu teilen. Stattdessen wird die Tür zugeschlagen – und mit ihr die Hoffnung vieler Gläubiger.
Der synodale Weg ist unbequem, ja. Er ist konfliktreich, manchmal unerquicklich, manchmal unerquicklich ehrlich. Aber genau darin liegt seine Wahrheit. Kirche, die keine Konflikte mehr aushält, hat aufgehört, Kirche der Menschen zu sein. Sie wird zu einer Institution, die sich selbst schützt – und dabei ihre Seele verliert.
Kardinal Woelki sagt, für ihn sei dieser Weg beendet. Für viele andere endet damit etwas ganz anderes: die Geduld. Das Vertrauen. Und vielleicht der letzte Grund, noch zu bleiben.
23.01.2026

Staatlicher Zynismus: Deutschland verrät seine afghanischen Ortskräfte
Was die Bundesrepublik Deutschland derzeit mit ihren afghanischen Ortskräften praktiziert, ist kein Verwaltungsversagen, kein unglücklicher Nebeneffekt komplexer Verfahren – es ist organisierter Wortbruch. Es ist die kalte, bürokratisch verkleidete Weigerung, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die im deutschen Auftrag gearbeitet haben und dafür nun mit dem Tod bedroht sind.
Deutschland hat diesen Menschen Schutz zugesagt. Schriftlich. Öffentlich. Wiederholt. Und Deutschland bricht dieses Versprechen – leise, schrittweise, ohne offenes Bekenntnis, aber mit tödlichen Konsequenzen.
Während Politiker in Sonntagsreden von „historischer Verantwortung“ und „Lehren aus Afghanistan“ sprechen, lassen dieselben staatlichen Stellen jene im Stich, die Deutschland vor Ort überhaupt handlungsfähig gemacht haben. Übersetzer, Fahrer, Ortskräfte der Bundeswehr und ziviler Organisationen werden heute so behandelt, als seien sie ein lästiger Kollateralschaden einer missliebigen Mission – Menschen, die man lieber vergessen möchte.
Besonders perfide ist die Methode: Die Bundesregierung widerruft Zusagen nicht offen, sie lässt sie schlicht verdorren. Verfahren werden endlos in die Länge gezogen, Anforderungen ins Absurde gesteigert, Sicherheitsprüfungen neu erfunden. Dokumente werden verlangt, die unter Taliban-Herrschaft faktisch nicht zu beschaffen sind. Fristen verstreichen ohne Antwort. Hoffnung wird verwaltet, bis sie stirbt.
Das ist kein Zufall. Das ist politische Absicht.
Denn hinter der Fassade aus „Sicherheitsbedenken“ und „Zuständigkeitsfragen“ verbirgt sich ein klarer Wille: möglichst wenige dieser Menschen nach Deutschland zu lassen – selbst dann nicht, wenn der deutsche Staat ihnen seine Schutzgarantie gegeben hat. Der Schutz von Leben wird migrationspolitischen Erwägungen geopfert, moralische Verpflichtung der Angst vor rechter Stimmungsmache.
Wer so handelt, darf nicht mehr von Werten sprechen.
Denn was ist ein Staat wert, dessen Zusagen nichts gelten, sobald sie politisch unbequem werden? Was ist ein Rechtsstaat wert, der formale Tricks einsetzt, um sich aus selbst eingegangenen Verpflichtungen herauszuwinden? Und was ist ein Land wert, das Menschen benutzt – und sie anschließend fallen lässt?
Die Bundesregierung trägt für dieses Versagen die volle Verantwortung. Sie kann sich nicht hinter Behörden, Prüfverfahren oder föderalen Strukturen verstecken. Jeder Tag des Wartens, jede abgelehnte Einreise trotz Zusage, jede verschleppte Entscheidung ist eine bewusste Handlung – und eine bewusste Gefährdung von Menschenleben.
Dass einige dieser Ortskräfte inzwischen untergetaucht sind, gefoltert wurden oder ermordet wurden, ist kein tragisches Randphänomen. Es ist die direkte Folge deutschen Nichthandelns.
Und die Konsequenzen reichen weit über Afghanistan hinaus. Wer heute sieht, wie Deutschland mit seinen ehemaligen Partnern umgeht, wird morgen keinen deutschen Versprechen mehr trauen. Keine lokale Kraft, kein ziviler Helfer, kein Partner in künftigen Missionen. Deutschlands Glaubwürdigkeit – mühsam über Jahrzehnte aufgebaut – wird hier in Zeitlupe demontiert.
Man wird sich später nicht damit herausreden können, man habe „es nicht besser gewusst“. Die Warnungen liegen seit Jahren auf dem Tisch. Die Schicksale sind dokumentiert. Die Verantwortung ist eindeutig.
Deutschland könnte handeln. Sofort. Es entscheidet sich täglich dagegen.
Das ist kein technisches Problem.
Es ist ein moralisches Versagen von historischem Ausmaß.
23.12.2025

Ich wünsche allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
„Die Botschaft von Weihnachten: Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis.“ – Martin Luther King
27.11.2025
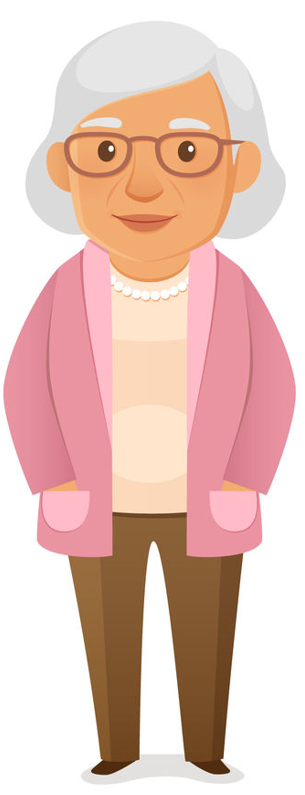
Die Rentenreform 2025: Ein Wellness-Wochenende für die Illusionen
Willkommen zur neuen Rentenreform!
Oder wie die Regierung es nennt: „Wir tun so, als würde alles gut“.
Die 48-Prozent-Haltelinie bleibt bestehen — hurra!
Die Rentenpolitik gleicht damit offiziell einem Altbau, der schon seit Jahren Risse hat, aber jedes Mal einfach nur neu gestrichen wird. „Da schauen wir in zehn Jahren nochmal hin“ — lautet das Motto. Ein bisschen wie die Frage, ob dieser alte Geschirrspüler es nochmal fünf Jahre macht … wahrscheinlich nicht, aber hey, Hauptsache jetzt nicht drüber nachdenken.
Kinder? Rentensystem? Ach ja, das war ja was…
Natürlich hat man jetzt auch die Kindererziehungszeiten auf dem Schirm.
Das ist die Reform-Version von: „Ich hab’s nicht vergessen, ich war nur sehr beschäftigt.“
Man erkennt endlich an, dass Eltern — also vor allem Mütter — tatsächlich arbeiten, bevor ihre Kinder groß genug sind, um als Steuerzahler die Rentenkasse zu retten.
Was für ein visionärer Gedanke! Und nur knapp 70 Jahre nach Einführung der modernen Rentenversicherung!
Aktivrente: Work hard, play never
Die Aktivrente erlaubt nun einen Zuverdienst im Rentenalter.
Man nennt das modern, flexibel, zukunftsfähig.
Ein Zyniker würde sagen: „Wir haben’s versaut, aber dafür dürft ihr jetzt länger schuften — ganz freiwillig!“
Die Botschaft ist klar:
Wer nach 45 Jahren Arbeit noch Schmerzen hat, hat einfach nicht genug Yoga gemacht.
Rentner sollen jetzt nicht mehr nur Oma und Opa sein, sondern „Silver Performer“, „Best-Ager-Fachkraft“, „Human Kapitalverwertung 2.0“.
Generationengerechtigkeit… oder so ähnlich
Die Reform verkauft sich als solidarisch, während sie im Hintergrund eigentlich zum größten „Buy Now, Pay Later“-Modell der Republik wird.
Wir stabilisieren die Rente — mit Geld, das wir nicht haben, das Leute ausgeben, die noch nicht geboren sind.
Das ist nicht mehr der Generationenvertrag.
Das ist ein Abo-Modell, das niemand abgeschlossen hat.
Gesellschaftliche Vision? Lieber nicht.
Eine linke Vision wäre:
Armut im Alter wirklich verhindern, soziale Ungleichheit reduzieren, unbezahlte Arbeit fair bewerten, Millionäre mal eine Schippe mehr beisteuern lassen.
Die Reformvision ist:
„Lasst uns über Rente reden… aber bitte nicht über Reichtum, Arbeitsbedingungen, Löhne oder Teilzeitfalle. Wir wollen den Leuten schließlich nicht den Abend verderben!“
Es ist ungefähr so fortschrittlich wie eine VHS-Kassette mit der Aufschrift „Bitte zurückspulen“.
Fazit: Eine Reform wie ein Ikea-Schrank
Ja, die Reform hat gute Ansätze.
Aber sie steht wacklig, passt nicht richtig, und am Ende fehlen immer ein paar Schrauben.
Und derjenige, der’s aufgebaut hat, sagt:
„Hauptsache, er hält bis nach der Wahl.“
25.11.2025

Die Sache mit den falschen Prioritäten
Es ist immer wohltuend, wenn endlich jemand sagt, woran es wirklich liegt. Eva Quadbeck zum Beispiel. Die Politik – so erfahren wir – hat einfach die falschen Prioritäten gesetzt. Zu viel Sozialstaat, zu wenig Bildung, und die Verwaltung wächst wie Hefeteig. Zack, Problem gelöst!
Man fragt sich ja, warum die Regierung da nicht früher draufgekommen ist. Vielleicht, weil sie noch damit beschäftigt war, die Renten für die Leute zu bezahlen, die sie wählen? Oder weil die Pflege älterer Menschen – man glaubt es kaum – nicht günstiger wird, nur weil man das Wort „Sparzwang“ besonders streng ausspricht?
Aber egal: Die wahren Kostentreiber sind natürlich diese lästigen Menschen, die Kinder kriegen, krank werden, alt werden oder Miete zahlen müssen. Da bleibt für Schulen einfach nichts übrig. Allein der Gedanke, man könnte vielleicht beides finanzieren, bringt das Raum-Zeit-Kontinuum des deutschen Haushaltsrechts ins Wanken.
Apropos: die Verwaltung. Sie bläht sich angeblich auf. Vermutlich ganz von selbst, wie ein Sauerteig unter der Heizung. Dass die Politik sie mit durchschnittlich 137 neuen Sonderprogrammen im Jahr füttert, kann natürlich keine Rolle spielen. Wer würde auch vermuten, dass komplexe Regeln komplexe Verwaltung brauchen? So ein Quatsch.
Und die Bildung? Ja, die leidet. Seit Jahrzehnten. Aber das hat sicher nichts damit zu tun, dass wir 16 Bundesländer haben, die sich gegenseitig mit dem pädagogischen Fingermaßstab schlagen und gleichzeitig behaupten, sie hätten das Rad erfunden. Nein, nein. Es liegt an den Sozialausgaben. Immer dran denken.
Und dann ist da noch dieses kleine Detail, das niemand so gern ausspricht: die Schuldenbremse. Sie sorgt zuverlässig dafür, dass Investitionen wegrationalisiert werden wie der Pausenhof einer Grundschule, auf dem man zufällig Windkraft bauen könnte. Aber wir wollen ja nicht kleinlich sein.
Am Ende bleibt die beruhigende Erkenntnis: Es ist eben alles eine Frage der Prioritäten. Und die Politik hätte längst die richtigen setzen können – wenn da nicht ständig diese störende Realität wäre.



