23.01.2026

Staatlicher Zynismus: Deutschland verrät seine afghanischen Ortskräfte
Was die Bundesrepublik Deutschland derzeit mit ihren afghanischen Ortskräften praktiziert, ist kein Verwaltungsversagen, kein unglücklicher Nebeneffekt komplexer Verfahren – es ist organisierter Wortbruch. Es ist die kalte, bürokratisch verkleidete Weigerung, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die im deutschen Auftrag gearbeitet haben und dafür nun mit dem Tod bedroht sind.
Deutschland hat diesen Menschen Schutz zugesagt. Schriftlich. Öffentlich. Wiederholt. Und Deutschland bricht dieses Versprechen – leise, schrittweise, ohne offenes Bekenntnis, aber mit tödlichen Konsequenzen.
Während Politiker in Sonntagsreden von „historischer Verantwortung“ und „Lehren aus Afghanistan“ sprechen, lassen dieselben staatlichen Stellen jene im Stich, die Deutschland vor Ort überhaupt handlungsfähig gemacht haben. Übersetzer, Fahrer, Ortskräfte der Bundeswehr und ziviler Organisationen werden heute so behandelt, als seien sie ein lästiger Kollateralschaden einer missliebigen Mission – Menschen, die man lieber vergessen möchte.
Besonders perfide ist die Methode: Die Bundesregierung widerruft Zusagen nicht offen, sie lässt sie schlicht verdorren. Verfahren werden endlos in die Länge gezogen, Anforderungen ins Absurde gesteigert, Sicherheitsprüfungen neu erfunden. Dokumente werden verlangt, die unter Taliban-Herrschaft faktisch nicht zu beschaffen sind. Fristen verstreichen ohne Antwort. Hoffnung wird verwaltet, bis sie stirbt.
Das ist kein Zufall. Das ist politische Absicht.
Denn hinter der Fassade aus „Sicherheitsbedenken“ und „Zuständigkeitsfragen“ verbirgt sich ein klarer Wille: möglichst wenige dieser Menschen nach Deutschland zu lassen – selbst dann nicht, wenn der deutsche Staat ihnen seine Schutzgarantie gegeben hat. Der Schutz von Leben wird migrationspolitischen Erwägungen geopfert, moralische Verpflichtung der Angst vor rechter Stimmungsmache.
Wer so handelt, darf nicht mehr von Werten sprechen.
Denn was ist ein Staat wert, dessen Zusagen nichts gelten, sobald sie politisch unbequem werden? Was ist ein Rechtsstaat wert, der formale Tricks einsetzt, um sich aus selbst eingegangenen Verpflichtungen herauszuwinden? Und was ist ein Land wert, das Menschen benutzt – und sie anschließend fallen lässt?
Die Bundesregierung trägt für dieses Versagen die volle Verantwortung. Sie kann sich nicht hinter Behörden, Prüfverfahren oder föderalen Strukturen verstecken. Jeder Tag des Wartens, jede abgelehnte Einreise trotz Zusage, jede verschleppte Entscheidung ist eine bewusste Handlung – und eine bewusste Gefährdung von Menschenleben.
Dass einige dieser Ortskräfte inzwischen untergetaucht sind, gefoltert wurden oder ermordet wurden, ist kein tragisches Randphänomen. Es ist die direkte Folge deutschen Nichthandelns.
Und die Konsequenzen reichen weit über Afghanistan hinaus. Wer heute sieht, wie Deutschland mit seinen ehemaligen Partnern umgeht, wird morgen keinen deutschen Versprechen mehr trauen. Keine lokale Kraft, kein ziviler Helfer, kein Partner in künftigen Missionen. Deutschlands Glaubwürdigkeit – mühsam über Jahrzehnte aufgebaut – wird hier in Zeitlupe demontiert.
Man wird sich später nicht damit herausreden können, man habe „es nicht besser gewusst“. Die Warnungen liegen seit Jahren auf dem Tisch. Die Schicksale sind dokumentiert. Die Verantwortung ist eindeutig.
Deutschland könnte handeln. Sofort. Es entscheidet sich täglich dagegen.
Das ist kein technisches Problem.
Es ist ein moralisches Versagen von historischem Ausmaß.
 Keine Kommentare
Keine Kommentare23.12.2025

Ich wünsche allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
„Die Botschaft von Weihnachten: Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis.“ – Martin Luther King
27.11.2025
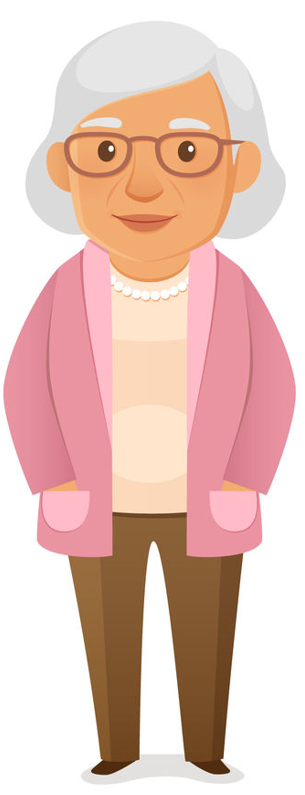
Die Rentenreform 2025: Ein Wellness-Wochenende für die Illusionen
Willkommen zur neuen Rentenreform!
Oder wie die Regierung es nennt: „Wir tun so, als würde alles gut“.
Die 48-Prozent-Haltelinie bleibt bestehen — hurra!
Die Rentenpolitik gleicht damit offiziell einem Altbau, der schon seit Jahren Risse hat, aber jedes Mal einfach nur neu gestrichen wird. „Da schauen wir in zehn Jahren nochmal hin“ — lautet das Motto. Ein bisschen wie die Frage, ob dieser alte Geschirrspüler es nochmal fünf Jahre macht … wahrscheinlich nicht, aber hey, Hauptsache jetzt nicht drüber nachdenken.
Kinder? Rentensystem? Ach ja, das war ja was…
Natürlich hat man jetzt auch die Kindererziehungszeiten auf dem Schirm.
Das ist die Reform-Version von: „Ich hab’s nicht vergessen, ich war nur sehr beschäftigt.“
Man erkennt endlich an, dass Eltern — also vor allem Mütter — tatsächlich arbeiten, bevor ihre Kinder groß genug sind, um als Steuerzahler die Rentenkasse zu retten.
Was für ein visionärer Gedanke! Und nur knapp 70 Jahre nach Einführung der modernen Rentenversicherung!
Aktivrente: Work hard, play never
Die Aktivrente erlaubt nun einen Zuverdienst im Rentenalter.
Man nennt das modern, flexibel, zukunftsfähig.
Ein Zyniker würde sagen: „Wir haben’s versaut, aber dafür dürft ihr jetzt länger schuften — ganz freiwillig!“
Die Botschaft ist klar:
Wer nach 45 Jahren Arbeit noch Schmerzen hat, hat einfach nicht genug Yoga gemacht.
Rentner sollen jetzt nicht mehr nur Oma und Opa sein, sondern „Silver Performer“, „Best-Ager-Fachkraft“, „Human Kapitalverwertung 2.0“.
Generationengerechtigkeit… oder so ähnlich
Die Reform verkauft sich als solidarisch, während sie im Hintergrund eigentlich zum größten „Buy Now, Pay Later“-Modell der Republik wird.
Wir stabilisieren die Rente — mit Geld, das wir nicht haben, das Leute ausgeben, die noch nicht geboren sind.
Das ist nicht mehr der Generationenvertrag.
Das ist ein Abo-Modell, das niemand abgeschlossen hat.
Gesellschaftliche Vision? Lieber nicht.
Eine linke Vision wäre:
Armut im Alter wirklich verhindern, soziale Ungleichheit reduzieren, unbezahlte Arbeit fair bewerten, Millionäre mal eine Schippe mehr beisteuern lassen.
Die Reformvision ist:
„Lasst uns über Rente reden… aber bitte nicht über Reichtum, Arbeitsbedingungen, Löhne oder Teilzeitfalle. Wir wollen den Leuten schließlich nicht den Abend verderben!“
Es ist ungefähr so fortschrittlich wie eine VHS-Kassette mit der Aufschrift „Bitte zurückspulen“.
Fazit: Eine Reform wie ein Ikea-Schrank
Ja, die Reform hat gute Ansätze.
Aber sie steht wacklig, passt nicht richtig, und am Ende fehlen immer ein paar Schrauben.
Und derjenige, der’s aufgebaut hat, sagt:
„Hauptsache, er hält bis nach der Wahl.“
25.11.2025

Die Sache mit den falschen Prioritäten
Es ist immer wohltuend, wenn endlich jemand sagt, woran es wirklich liegt. Eva Quadbeck zum Beispiel. Die Politik – so erfahren wir – hat einfach die falschen Prioritäten gesetzt. Zu viel Sozialstaat, zu wenig Bildung, und die Verwaltung wächst wie Hefeteig. Zack, Problem gelöst!
Man fragt sich ja, warum die Regierung da nicht früher draufgekommen ist. Vielleicht, weil sie noch damit beschäftigt war, die Renten für die Leute zu bezahlen, die sie wählen? Oder weil die Pflege älterer Menschen – man glaubt es kaum – nicht günstiger wird, nur weil man das Wort „Sparzwang“ besonders streng ausspricht?
Aber egal: Die wahren Kostentreiber sind natürlich diese lästigen Menschen, die Kinder kriegen, krank werden, alt werden oder Miete zahlen müssen. Da bleibt für Schulen einfach nichts übrig. Allein der Gedanke, man könnte vielleicht beides finanzieren, bringt das Raum-Zeit-Kontinuum des deutschen Haushaltsrechts ins Wanken.
Apropos: die Verwaltung. Sie bläht sich angeblich auf. Vermutlich ganz von selbst, wie ein Sauerteig unter der Heizung. Dass die Politik sie mit durchschnittlich 137 neuen Sonderprogrammen im Jahr füttert, kann natürlich keine Rolle spielen. Wer würde auch vermuten, dass komplexe Regeln komplexe Verwaltung brauchen? So ein Quatsch.
Und die Bildung? Ja, die leidet. Seit Jahrzehnten. Aber das hat sicher nichts damit zu tun, dass wir 16 Bundesländer haben, die sich gegenseitig mit dem pädagogischen Fingermaßstab schlagen und gleichzeitig behaupten, sie hätten das Rad erfunden. Nein, nein. Es liegt an den Sozialausgaben. Immer dran denken.
Und dann ist da noch dieses kleine Detail, das niemand so gern ausspricht: die Schuldenbremse. Sie sorgt zuverlässig dafür, dass Investitionen wegrationalisiert werden wie der Pausenhof einer Grundschule, auf dem man zufällig Windkraft bauen könnte. Aber wir wollen ja nicht kleinlich sein.
Am Ende bleibt die beruhigende Erkenntnis: Es ist eben alles eine Frage der Prioritäten. Und die Politik hätte längst die richtigen setzen können – wenn da nicht ständig diese störende Realität wäre.
07.11.2025
 „Ich bin nicht bereit, über die Kürzungen bei Armen zu reden, wenn wir nicht über Reichtum gesprochen haben.“
„Ich bin nicht bereit, über die Kürzungen bei Armen zu reden, wenn wir nicht über Reichtum gesprochen haben.“
Über Gerechtigkeit reden heißt, über Reichtum reden
Wenn in politischen Debatten von „Sparmaßnahmen“, „Haushaltsdisziplin“ oder „Kürzungen im Sozialetat“ die Rede ist, richtet sich der Blick meist auf diejenigen, die ohnehin wenig haben: Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen, Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente, oder Familien, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Der Satz „Ich bin nicht bereit, über die Kürzungen bei Armen zu reden, wenn wir nicht über Reichtum gesprochen haben“ bringt eine zentrale Wahrheit auf den Punkt: Soziale Gerechtigkeit lässt sich nicht verhandeln, wenn wir nur über Mangel, aber nicht über Überfluss sprechen.
Einseitige Verantwortung – wer trägt die Last?
In Krisenzeiten wird oft argumentiert, dass „alle ihren Beitrag leisten müssen“. Doch in der Praxis bedeutet das fast immer, dass die Schwächeren sparen sollen. Sozialleistungen werden gekürzt, öffentliche Einrichtungen geschlossen, und prekär Beschäftigte tragen die größte Unsicherheit. Dabei bleibt häufig unbeachtet, dass Vermögende und Großkonzerne im gleichen Moment von Steuerprivilegien, Erbschaftsvergünstigungen oder Kapitalerträgen profitieren, die kaum belastet werden.
Über Kürzungen bei Armen zu sprechen, ohne über Privilegien der Reichen zu reden, verschiebt den Diskurs. Es tut so, als seien Armut und Ungleichheit naturgegeben, nicht das Ergebnis politischer Entscheidungen.
Reichtum ist politisch – und nicht nur privat
Reichtum wird oft als individuelle Leistung dargestellt: als Ergebnis von Fleiß, Talent oder Unternehmergeist. Diese Erzählung blendet jedoch aus, dass Reichtum immer auch von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt – von Steuergesetzen, Bildungssystemen, öffentlicher Infrastruktur und sozialem Frieden, von Erbschaften ganz zu schweigen.
Ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es auf funktionierende Straßen, gut ausgebildete Arbeitskräfte und ein stabiles Rechtssystem zurückgreifen kann – alles Leistungen der Allgemeinheit. Wer also über Gerechtigkeit sprechen will, muss auch fragen: Welchen Beitrag leisten die Wohlhabenden zur Gemeinschaft, von der sie profitieren?
Das Schweigen über Reichtum ist Teil des Problems
In vielen Gesellschaften gilt es als unhöflich, über Geld oder Vermögen zu reden. Diese kulturelle Scheu schützt jedoch die bestehenden Machtverhältnisse. Während Armut öffentlich sichtbar und oft stigmatisiert ist, bleibt Reichtum meist unsichtbar – hinter verschlossenen Türen, in Steuerparadiesen oder in Form von Finanzanlagen.
Wenn Politik über Kürzungen im Sozialbereich spricht, ohne gleichzeitig über Vermögensverteilung und Steuerpolitik zu reden, dann wird das Bild verzerrt: Es entsteht der Eindruck, als gäbe es kein Geld, während es in Wahrheit nur ungleich verteilt ist.
Warum die Diskussion über Reichtum notwendig ist
- Gerechtigkeit: Ein soziales System kann nur dann als gerecht gelten, wenn die Lasten und Chancen fair verteilt sind.
- Demokratie: Extreme Ungleichheit gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politische Teilhabe.
- Wirtschaftliche Stabilität: Eine Gesellschaft, in der Reichtum konzentriert ist, erlebt schwächeren Konsum, geringere Aufstiegschancen und tiefere soziale Spannungen.
Deshalb ist es kein Nebenschauplatz, sondern eine zentrale Frage politischer Verantwortung, wie Reichtum entsteht, wächst – und wie er besteuert wird.
Fazit
Wer über Armut reden will, muss über Reichtum reden. Denn beides sind zwei Seiten derselben Medaille. Eine Gesellschaft, die von den Schwächsten Sparsamkeit fordert, ohne von den Stärksten Verantwortung einzufordern, verliert ihre moralische und soziale Balance.
Der Satz „Ich bin nicht bereit, über die Kürzungen bei Armen zu reden, wenn wir nicht über Reichtum gesprochen haben“ ist deshalb kein bloßer Protest, sondern ein Appell an Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und politische Fairness.
06.11.2025
 Julia Klöckner (CDU) Bundestagspräsidentin fordert ein Verbot der Prostitution.
Julia Klöckner (CDU) Bundestagspräsidentin fordert ein Verbot der Prostitution.
Was ist davon zu halten? An dieser Stelle möchte ich einmal Aspekte mit Blick auf Für und Wider darstellen.
Aspekte, die für ihre Forderung sprechen
- Schutz vor Ausbeutung und Gewalt
Klöckner argumentiert, die derzeitigen gesetzlichen Regelungen – etwa das Prostituiertenschutzgesetz von 2017 – hätten „weder … noch“ ausreichend die Rechte der Frauen in der Prostitution gestärkt. Sie verweist auf Machtgefälle, Zwang, Gewalt und damit fehlende Freiwilligkeit in vielen Fällen. Aus dieser Perspektive ist ein Verbot – insbesondere ein Modell wie das sogenannte nordische Modell (Strafbarkeit der Freier, Unterstützung der Prostituierten) – eine Möglichkeit, die Nachfrage zu senken und damit strukturelle Ungleichheiten und Ausbeutung zu bekämpfen. - Symbolische Bedeutung für Frauenrechte
Klöckner macht geltend: Wenn man über Frauenrechte spricht, aber gleichzeitig sagt, Prostitution sei ein „Beruf wie jeder andere“, dann sei das „nicht nur lächerlich, sondern Verächtlichmachung von Frauen“. Damit setzt sie einen Fokus auf das Selbstverständnis darüber, wie Gesellschaft Frauen‐ und Männerrollen wahrnimmt und wie Arbeit, Körper, Sexualität miteinander verbunden sind. - Vorbildfunktion anderer Länder
Als Referenz bringt sie Länder wie Schweden oder Norwegen ins Spiel, in denen das nordische Modell umgesetzt wurde. Die Idee: Ein Systemwechsel zugunsten von Regulierung, die nicht nur auf Kontrolle durch das Gewerberecht setzt, sondern Nachfrage und Umfeld stärker in den Blick nimmt.
Aspekte, die gegen ihre Forderung sprechen oder kritisch bedacht werden müssen
- Risiken der Verdrängung und Kriminalisierung
Studien und Stellungnahmen warnen davor, dass ein reines Kaufverbot (ohne gleichzeitig funktionierende Unterstützungs- und Ausstiegsangebote) die Arbeitsbedingungen von Prostituierten verschlechtern kann, z. B. durch Verlagerung in den Untergrund, reduzierte Sicherheit, schlechterer Gesundheitsversorgung. Das heißt: Wenn der Verkauf von sexuellen Dienstleistungen zwar straffrei bleibt (wie im nordischen Modell), aber die Nachfrage sanktioniert wird, besteht das Risiko, dass die Szene informeller wird und damit weniger kontrollierbar und schutzloser. - Freiwilligkeit und Selbstbestimmung
Ein zentrales ethisches Argument: Viele vertreten die Position, dass erwachsene Menschen – wenn sie wirklich freiwillig handeln – das Recht haben sollten, über ihre Arbeitsformen, auch die Sexarbeit, zu entscheiden. Ein umfassendes Verbot könnte diese Autonomie einschränken.
Das erwähnte Institut für Menschenrechte weist darauf hin, dass Prostitution aus menschenrechtlicher Perspektive als autonome Entscheidung betrachtet werden müsse. Wenn aber Freiwilligkeit in der Praxis kaum gesichert ist, dann stellt sich die Frage, wie wir mit Realität und Idealen umgehen. - Umsetzung und Nebenwirkungen
– Ein Verbot müsste begleitet werden von effektiven Ausstiegs‐, Bildungs‐ und Betreuungsprogrammen für Prostituierte. Ohne diese läuft man Gefahr, dass Menschen in prekäre Situationen gedrängt werden. Klöckner spricht selbst von „Hilfe beim Ausstieg“.
– Es müsste geprüft werden, ob das nordische Modell in Deutschland ohne Anpassungen funktioniert – etwa vor dem Hintergrund der grenzüberschreitenden Mobilität, der Immobilien‐ und Gewerbesituation, der Sozialpolitik. Studien zeigen, dass der Rückgang der Nachfrage nicht automatisch mit weniger Menschenhandel oder besserem Schutz einhergeht.
Fazit
Ich halte die Forderung von Klöckner für verständlich und legitim: Es gibt solide Gründe, warum das aktuelle System der Prostitution in Deutschland kritisch gesehen wird – insbesondere im Hinblick auf Frauenrechte, Gewalt, Machtverhältnisse und Ausbeutung. Dass hier Reformbedarf besteht, ist unstrittig.
Allerdings erscheint mir ein pauschales Verbot ohne Begleitmaßnahmen problematisch. Wenn ein Verbot kommt, dann sollte es integriert sein in ein Konzept, das folgende Elemente enthält:
- Massive Ausstiegshilfen für Betroffene (Finanzen, Qualifikation, soziale Absicherung)
- Gesundheits‐ und Sozialangebote, speziell für vulnerable Gruppen
- Kontrolle und Regulierung des Umfeldes (Zuhälterei, Menschenhandel)
- Prävention und Sensibilisierung – insbesondere für Perspektiven, in denen Menschen keine andere Wahl sehen
- Monitoring und Evaluation, ob das Modell funktioniert und welche unerwünschten Effekte auftreten.
Kurz gesagt: Wenn Klöckners Ansatz ernst genommen wird, dann bleibt das Ziel nicht nur „Verbot“, sondern „Neugestaltung von Machtverhältnissen, Schutz und Freiheit“. Ohne diesen Zusatz droht, dass Schutzsysteme ausgehöhlt zu werden trotz guter Absicht.
29.10.2025

Militärische Zeitenwende
Kontext: Trojanows Kritik
Ilija Trojanow, bekannt als Schriftsteller und politisch engagierter Intellektueller, äußert sich häufig pazifistisch und globalisierungskritisch. Seine Aussage in der taz zielt auf die gegenwärtige sicherheitspolitische Wende Deutschlands und Europas — also auf Aufrüstung, höhere Verteidigungsausgaben (z. B. das 100-Milliarden-Sondervermögen), Waffenlieferungen an die Ukraine und den Ausbau der NATO-Abschreckung.
Wenn er schreibt, die Aufrüstungspolitik führe in eine Sackgasse und man müsse sich vom Mythos der Wehrhaftigkeit verabschieden, meint er wohl:
- Militärische Stärke garantiere keine Sicherheit.
- Abschreckung verstärke Spiralen des Misstrauens (Sicherheitsdilemma).
- Frieden entstehe nicht durch Waffen, sondern durch Diplomatie, Kooperation und strukturelle Veränderungen (Abrüstung, Gerechtigkeit, Klimaschutz, etc.).
Das ist eine im linkspazifistischen Spektrum verbreitete Position, die auf die langfristigen Kosten und psychologischen Dynamiken militärischer Logik hinweist.
Argumente, die Trojanows Sicht unterstützen
- Sicherheitsdilemma: Mehr Aufrüstung auf einer Seite provoziert Aufrüstung auf der anderen. Statt Stabilität entsteht Instabilität.
- Ökonomische und soziale Verdrängungseffekte: Hohe Rüstungsausgaben binden Ressourcen, die für soziale, ökologische und humanitäre Aufgaben fehlen.
- Historische Erfahrungen: Das Vertrauen in Abschreckung hat Kriege nicht immer verhindert (z. B. Erster Weltkrieg trotz Rüstungswettlauf).
- Moralisch-ethische Dimension: Militarisierung verfestigt Feindbilder und rechtfertigt Gewalt als „normalen“ Bestandteil von Politik.
- Globale Perspektive: Länder des globalen Südens erleben westliche Wehrhaftigkeit oft als hegemoniales Dominanzverhalten, nicht als Friedenspolitik.
Gegenargumente zur „Sackgasse“-These
- Realistische Perspektive: In einer Welt, in der Staaten wie Russland oder China militärisch Druck ausüben, ist Wehrhaftigkeit Voraussetzung für Souveränität und Friedenssicherung.
→ Ohne glaubhafte Abschreckung könnte Aggression belohnt werden (siehe Ukraine). - Wehrhaftigkeit ≠ Militarismus: Eine defensive, regelbasierte Sicherheitspolitik kann zugleich friedensorientiert sein — z. B. Abschreckung und Diplomatie.
- Europäische Verantwortung: Ein ungeschütztes Europa würde entweder erpressbar oder abhängig (z. B. von den USA bleiben), was langfristig politische Selbstbestimmung schwächt.
- Menschliche Schutzpflicht: Pazifismus ist moralisch ehrenwert, aber wenn er zur Ohnmacht führt, kann er unmoralisch werden — etwa wenn er Diktatoren freie Hand lässt.
Differenzierte Einordnung
Trojanows Warnung vor dem „Mythos der Wehrhaftigkeit“ ist eine notwendige Mahnung, dass militärische Logik nicht zum alleinigen Paradigma werden darf.
Aber die komplette Absage an Wehrhaftigkeit verkennt die Realität autoritärer Machtpolitik.
Ein verantwortlicher Mittelweg wäre:
- Wehrhaftigkeit als ultima ratio, nicht als Leitideologie;
- Rüstungspolitik gekoppelt an Diplomatie, Rüstungskontrolle und Prävention;
- Demokratische Kontrolle über militärische Entscheidungen;
- Gesellschaftliche Resilienz auch jenseits des Militärs (Energieunabhängigkeit, Informationssouveränität, Bildung).
- Fazit
Trojanow erinnert an eine zentrale moralische Wahrheit: Frieden kann nicht dauerhaft auf Waffen gebaut werden.
Aber Sicherheitspolitik, die diese Wahrheit ignoriert, läuft Gefahr, realitätsfremd zu werden.
Eine kluge Politik muss also wehrhaft, aber nicht kriegerisch, realistisch, aber nicht zynisch, pazifistisch im Ziel, aber pragmatisch im Weg sein.
25.10.2025
 Verbrenner-Aus verschieben?
Verbrenner-Aus verschieben?
Die jüngste Forderung der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), das geplante Verbot von Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor über das Jahr 2035 hinaus zu verschieben, steht im Spannungsfeld zwischen Klimapolitik, Wirtschaftsinteressen und föderaler Machtpolitik. Eine genaue Betrachtung zeigt, dass hinter dieser Initiative weniger eine technologische oder ökologische Notwendigkeit steht, sondern vielmehr ein Ausdruck politischer und ökonomischer Interessenkonflikte.
Politische Interessenlage
Die MPK vereint Länderchefs unterschiedlicher Parteien, deren Positionen stark von den wirtschaftlichen Strukturen ihrer Bundesländer abhängen. Besonders in Automobilregionen wie Bayern, Baden-Württemberg oder Niedersachsen stehen viele Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der Verbrennertechnologie in Verbindung. Die Forderung nach einer Verschiebung ist daher auch als Versuch zu verstehen, den Druck auf die Landeswirtschaft zu verringern und zugleich Wählergruppen zu beruhigen, die den Wandel zur Elektromobilität skeptisch sehen.
Zudem fällt die Diskussion in eine Phase zunehmender politischer Polarisierung: Klimapolitische Maßnahmen werden vermehrt als soziale Belastung wahrgenommen, was populistischen Kräften Auftrieb verschafft. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten reagieren daher auch auf den wachsenden gesellschaftlichen Widerstand gegen „grüne“ Transformationsprojekte.
Ökonomische Argumente und industriepolitische Dimension
Ökonomisch wird die Forderung mit der Sicherung von Arbeitsplätzen und der vermeintlichen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie begründet. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass die Industrie selbst längst auf Elektromobilität setzt. Unternehmen wie Volkswagen oder Mercedes-Benz haben strategische Entscheidungen getroffen, die unabhängig von politischen Fristen auf den Ausstieg aus dem Verbrenner abzielen. Eine politische Verzögerung könnte daher weniger die Industrie schützen als vielmehr Investitionssicherheit und Innovationsdruck schwächen.
Zudem riskiert Deutschland, seine technologische Führungsposition zu verlieren, wenn es im internationalen Vergleich zögert. Andere Märkte, vor allem China und die USA, treiben die Elektromobilität mit Nachdruck voran und fördern damit neue Wertschöpfungsketten, während Deutschland Gefahr läuft, sich in alten Strukturen zu verfangen.
Umwelt- und Klimapolitische Bewertung
Aus klimapolitischer Sicht wäre eine Verschiebung des Verbrenner-Aus ein Rückschritt. Der Verkehrssektor ist einer der größten CO₂-Verursacher, und die bisherigen Reduktionsmaßnahmen reichen nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Eine Verzögerung würde nicht nur das deutsche Engagement für den Klimaschutz schwächen, sondern auch die Glaubwürdigkeit der EU-Klimapolitik untergraben. Sie könnte als Signal verstanden werden, dass politische Ziele zugunsten kurzfristiger ökonomischer Interessen verhandelbar sind – mit möglichen Folgen für die internationale Klimadiplomatie.
Föderale Dynamiken und Symbolpolitik
Die Forderung der MPK verdeutlicht zudem den wachsenden Einfluss der Länder auf die nationale Klimapolitik. Während die Bundesregierung in Brüssel auf europäische Einigung setzt, nutzen die Länder ihre Plattform, um eigene Akzente zu setzen. Die Diskussion zeigt, wie stark klimapolitische Fragen inzwischen zum Schauplatz föderaler Profilierung geworden sind. In diesem Sinne ist die Forderung auch als Symbolpolitik zu interpretieren – weniger als konkreter Versuch, eine EU-Entscheidung zu verändern, sondern als Signal an Wählerinnen und Wähler, dass die Länder ihre Interessen gegenüber „Brüssel“ und Berlin verteidigen.
Fazit
Die Forderung, das Verbrenner-Aus zu verschieben, ist politisch verständlich, aber strategisch kurzsichtig. Sie dient vor allem der kurzfristigen politischen Stabilisierung in den Ländern, während sie langfristig Investitionssicherheit, Klimaziele und internationale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Der Konflikt steht exemplarisch für die Spannungen zwischen ökologischer Transformation, wirtschaftlicher Anpassung und föderaler Interessenpolitik in Deutschland.



